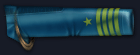- Beiträge: 4455
- Dank erhalten: 1
- CommCenter
- Weltraumsimulationen
- Wing Commander Serie
- Wing Commander-Romane: Von Freedom Flight bis False Colors
 Wing Commander-Romane: Von Freedom Flight bis False Colors
Wing Commander-Romane: Von Freedom Flight bis False Colors
9 Jahre 1 Monat her #28679
von Arrow
"Ich würde immer eine Maschine bevorzugen, die um einen schweren Jäger Kreise fliegen kann, wenn es sein muss.“ Alec "Ninja" Crisologo, Wing Commander Saga
Arrow antwortete auf Wing Commander-Romane: Von Freedom Flight bis False Colors
Los geht’s! Ich habe mich entschlossen, die Besprechung dieses Mal in mehrere Blöcke aufzuteilen und Stück für Stück zu vervollständigen. Damit kann ich zum einen meine Zeit besser einteilen, zum anderen überlade ich das Forum nicht mit zu großen Textblöcken. Des Weiteren habe ich die Lektüre noch nicht ganz abgeschlossen. Im Vergleich zu früheren Besprechungen werde ich diesmal detaillierter auf die Inhalte eingehen, um nicht zu sagen, eingehen müssen. Wer den Roman also noch nicht kennt und völlig ubeleckt an die Lektüre herangehen möchte, sei hiermit vorgewarnt. Andererseits ist das Buch nun seit bereits 15 Jahre auf dem Markt (wo es allmählich wieder verschwindet), und da möchte ich ehrlich gesagt auch nicht ständig um den heißen Brei herumreden.
Erzählrahmen und Darstellung
Der Roman „Wing Commander Die Bedrohung (Action Stations)“ erschien in den USA Ende 1997 / Anfang 1998 und ist der letzte, der komplett aus der Feder von William Forstchen stammt. Im Verlag Bastei Lübbe erschien er im Jahr 2000 auf Deutsch. Nach der 1995 (also noch vor dem Spiel) erschienenen Romanadaption zu WCIV springt Forstchen hiermit an den Anfang der WC-Chronologie und schildert die Ereignisse des Kriegsausbruchs zwischen Konföderation und Kilrathi-Imperium. Erstaunlicherweise weicht Forstchen mit „Action Stations“ erzähltechnisch gleich zu Anfang von seinen früheren Romanen ab. Anstatt wie üblich unmittelbar zu erzählen, stellt er seinem Buch das Vorwort eines Militärhistorikers der konföderierten Akademie voran, der nunmehr selbst zum (fiktiven) Autor der Vorkriegsereignisse wird. Deren Schilderung wird im narratologischen Rahmen von „Action Stations“ somit zu einer Binnenerzählung und das Ganze gleichzeitig zu einem fiktiven historischen Roman, der acht Jahre nach dem Krieg mit den Kilrathi erscheint. Wieso wählt Forstchen hier erstmals einen solchen vermittelnden Handlungsrahmen innerhalb der Welt von Wing Commander? Nun, möglicherweise möchte er auf diese Weise seine plötzliche Hinwendung zu dieser frühen Phase des Konflikts legitimieren, und dies nimmt er durch seinen fiktiven Historiker indirekt vor: Dieser will nämlich nach den Ereignissen des Grenzweltenkonflikts einen genaueren Blick auf die schillernde Person Geoffrey Tolwyn werfen. Um Tolwyns Werdegang nachvollziehen zu können, so der Akademiker, bedürfe es eines Rückblicks auf dessen Karrierebeginn – und dieser fällt zweifelsohne nun einmal mit dem Kriegsanfang zusammen. Klingt zwar durchaus verständlich, doch wieso sollte ein gestandener Historiker zur Vermittlung der Geschichte ausgerechnet auf das Medium des Romans zurückgreifen? An dieser Stelle muss sich wiederum der Historiker erklären, der die Frage im Vorwort auch sogleich aufgreift: Der Grund sei schlicht die Flexibilität! Akzeptieren wir dies erst mal, und stellen wir nicht die Frage nach dem Unterhaltungswert einer derartigen Vorgehensweise...
Nachdem sich also realer Autor und fiktiver Autor auf diese interessante Weise gleichermaßen gerechtfertigt haben, müssen wir uns als Leser eines gleich vor Augen führen: Die "Bedrohung"/ "Action Stations" ist in seinem (fiktiven) Selbstverständnis ein Historischer Roman, der aus praktischen Gründen überhaupt erst verfasst wurde. Die groben geschichtlichen Ereignisse mögen also alle korrekt wiedergegeben sein, doch ob sich alles haargenau so abgespielt hat, wissen wir nicht, da sich unser fiktiver Autor auf Augenzeugenberichte und Erinnerungen einiger der damals Beteiligten beruft. Dazu kommt zwangsläufig ein gerüttelt Maß an künstlerischer Freiheit mit all seinen dramaturgischen Straffungen, Dehnungen, Auslassungen oder Zuspitzungen. William Forstchen hat sich bewusst für diese Form der Fiktionialisierung entschieden, und dies sollten wir stets im Hinterkopf behalten, wenn wir den Roman lesen.
Zur Handlung
Es ist das Jahr 2634, zwanzig Jahre vor den Ereignissen des ersten WC-Spiels. Die Terranische Konföderation blickt auf hundert Jahre des Friedens zurück, und ihr Präsident befindet sich im Wahlkampf für seine erneute Kandidatur. Der Erstkontakt mit den Kilrathi (TCS Iason-Zwischenfall) liegt bereits fünf Jahre zurück. Nach mehreren Zwischenfällen an den Rändern des Konföderationsraums wurde zwischen Kilrah und Erde ein vorläufiges Abkommen geschlossen, das die Grenzen beider Einflussphären feststeckt; zwischen beiden Mächten wurde darüber hinaus eine demilitärisierte Zone geschaffen. Obwohl die Kilrathi dieses Abkommen immer wieder brechen, ist die konföderierte Politik nicht an einem Krieg interessiert, schon gar nicht der Präsident, der seinen Wahlkampf nicht durch einen größeren Konflikt gefährden will. Die Warnungen des Militärnachrichtendienstes vor einer feindlichen Großoffensive werden von Regierung und Opposition samt und sonders in den Wind geschlagen und sogar als reine Profilierungsmaßnahme des Militärs zurückgewiesen. Stattdessen halten sie die Kilrathi für eine unbedeutende, drittklassige Raummacht, die man im Zweifelsfall durch einen begrenzten Militärschlag in ihre Grenzen weisen sollte. Ein gefährlicher Irrtum! Die Kilrathi haben geschickt dafür gesorgt, dass die Menschen ihre wahren Absichten und Fähigkeiten unterschätzen. Erst wenige Jahrzehnte sind seit ihrem letzten Krieg gegen die Spezies der Varni vergangen, die vollständig besiegt und versklavt wurde. Nun bereiten sie sich auf den nächsten Angriffskrieg vor, der, wie so oft in ihrer Geschichte, mit dem „Jak-tu“, einem alles entscheidenden Überraschungsschlag beginnen soll. Vor der Menschheit haben sie wenig Respekt, sie gilt in den Augen der Kilrathi als schwach und dekadent. Mit großem Interesse verfolgen sie die unverschlüsselten Übertragungen der Konföderation, während sie selbst nur das nach außen dringen lassen, was sie die Konföderierten wissen lassen wollen. Die Menschheit bekommt lediglich veraltete Schiffe der Kilrathi zu sehen und verfällt dem Trugschluss, sie wäre technologisch im Vorteil. Derweil ist der Krieg für die Katzen längst beschlossene Sache: Ein gewaltiger Erstschlag gegen die Flottenbasis der Siebten Flotte auf und um McAuliffe soll den Krieg schnell entscheiden. Um die Chancen zu erhöhen, wählen die Kilrathi einen Feiertag für ihren Angriff aus: Der „Tag der Konföderation“, an dem die Flotte in allgemeiner Partylaune versinkt, soll den Menschen zum Verhängnis werden. Admiral Banbridge, der dieses Manöver voraussieht, sind jedoch die Hände gebunden. Eine große Mobilmachung der Flotte darf er nicht eigenmächtig befehlen. Ihm bleibt keine andere Wahl, als ein geheimes Kommandounternehmen ins Grenzgebiet zu den Kilrathi zu entsenden, um handfeste Beweise für die Offensive zu sammeln, die die Regierung überzeugen sollen. Das Unternehmen besteht aus drei Männern: Commander Winston Turner, ein ehemaliger Geheimdienstler und nun Professor an der Akademie, Lieutenant Vance Richards, ein Kampfpilot, sowie der frischgebackene Akademieabsolvent Midshipman Geoffrey Tolwyn. In den Randkolonien des Landreichs angekommen, chartern die drei das Schiff eines jungen Privateers und Schmugglers. Der Eigner ist niemand anderes als Hans Kruger (oder Krüger). Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt auf einer Schmuggler-Raumstation der Kilrathi gelangen sie schließlich an die benötigten Informationen, die den bevorstehenden Krieg beweisen. Währenddessen beginnt die Konföderation mit einer halbgaren Bestrafungsaktion gegen Grenzsysteme der Kilrathi. Offiziell herrscht noch kein Kriegszustand, doch die konföderierte Regierung hält diese Aktion für völlig ausreichend.
Turner, Tolwyn und Richards sind mit ihren Daten derweil auf dem Weg nach McAuliffe, um die Erde vor dem bevorstehenden Angriff zu warnen.
Erzählrahmen und Darstellung
Der Roman „Wing Commander Die Bedrohung (Action Stations)“ erschien in den USA Ende 1997 / Anfang 1998 und ist der letzte, der komplett aus der Feder von William Forstchen stammt. Im Verlag Bastei Lübbe erschien er im Jahr 2000 auf Deutsch. Nach der 1995 (also noch vor dem Spiel) erschienenen Romanadaption zu WCIV springt Forstchen hiermit an den Anfang der WC-Chronologie und schildert die Ereignisse des Kriegsausbruchs zwischen Konföderation und Kilrathi-Imperium. Erstaunlicherweise weicht Forstchen mit „Action Stations“ erzähltechnisch gleich zu Anfang von seinen früheren Romanen ab. Anstatt wie üblich unmittelbar zu erzählen, stellt er seinem Buch das Vorwort eines Militärhistorikers der konföderierten Akademie voran, der nunmehr selbst zum (fiktiven) Autor der Vorkriegsereignisse wird. Deren Schilderung wird im narratologischen Rahmen von „Action Stations“ somit zu einer Binnenerzählung und das Ganze gleichzeitig zu einem fiktiven historischen Roman, der acht Jahre nach dem Krieg mit den Kilrathi erscheint. Wieso wählt Forstchen hier erstmals einen solchen vermittelnden Handlungsrahmen innerhalb der Welt von Wing Commander? Nun, möglicherweise möchte er auf diese Weise seine plötzliche Hinwendung zu dieser frühen Phase des Konflikts legitimieren, und dies nimmt er durch seinen fiktiven Historiker indirekt vor: Dieser will nämlich nach den Ereignissen des Grenzweltenkonflikts einen genaueren Blick auf die schillernde Person Geoffrey Tolwyn werfen. Um Tolwyns Werdegang nachvollziehen zu können, so der Akademiker, bedürfe es eines Rückblicks auf dessen Karrierebeginn – und dieser fällt zweifelsohne nun einmal mit dem Kriegsanfang zusammen. Klingt zwar durchaus verständlich, doch wieso sollte ein gestandener Historiker zur Vermittlung der Geschichte ausgerechnet auf das Medium des Romans zurückgreifen? An dieser Stelle muss sich wiederum der Historiker erklären, der die Frage im Vorwort auch sogleich aufgreift: Der Grund sei schlicht die Flexibilität! Akzeptieren wir dies erst mal, und stellen wir nicht die Frage nach dem Unterhaltungswert einer derartigen Vorgehensweise...
Nachdem sich also realer Autor und fiktiver Autor auf diese interessante Weise gleichermaßen gerechtfertigt haben, müssen wir uns als Leser eines gleich vor Augen führen: Die "Bedrohung"/ "Action Stations" ist in seinem (fiktiven) Selbstverständnis ein Historischer Roman, der aus praktischen Gründen überhaupt erst verfasst wurde. Die groben geschichtlichen Ereignisse mögen also alle korrekt wiedergegeben sein, doch ob sich alles haargenau so abgespielt hat, wissen wir nicht, da sich unser fiktiver Autor auf Augenzeugenberichte und Erinnerungen einiger der damals Beteiligten beruft. Dazu kommt zwangsläufig ein gerüttelt Maß an künstlerischer Freiheit mit all seinen dramaturgischen Straffungen, Dehnungen, Auslassungen oder Zuspitzungen. William Forstchen hat sich bewusst für diese Form der Fiktionialisierung entschieden, und dies sollten wir stets im Hinterkopf behalten, wenn wir den Roman lesen.
Zur Handlung
Es ist das Jahr 2634, zwanzig Jahre vor den Ereignissen des ersten WC-Spiels. Die Terranische Konföderation blickt auf hundert Jahre des Friedens zurück, und ihr Präsident befindet sich im Wahlkampf für seine erneute Kandidatur. Der Erstkontakt mit den Kilrathi (TCS Iason-Zwischenfall) liegt bereits fünf Jahre zurück. Nach mehreren Zwischenfällen an den Rändern des Konföderationsraums wurde zwischen Kilrah und Erde ein vorläufiges Abkommen geschlossen, das die Grenzen beider Einflussphären feststeckt; zwischen beiden Mächten wurde darüber hinaus eine demilitärisierte Zone geschaffen. Obwohl die Kilrathi dieses Abkommen immer wieder brechen, ist die konföderierte Politik nicht an einem Krieg interessiert, schon gar nicht der Präsident, der seinen Wahlkampf nicht durch einen größeren Konflikt gefährden will. Die Warnungen des Militärnachrichtendienstes vor einer feindlichen Großoffensive werden von Regierung und Opposition samt und sonders in den Wind geschlagen und sogar als reine Profilierungsmaßnahme des Militärs zurückgewiesen. Stattdessen halten sie die Kilrathi für eine unbedeutende, drittklassige Raummacht, die man im Zweifelsfall durch einen begrenzten Militärschlag in ihre Grenzen weisen sollte. Ein gefährlicher Irrtum! Die Kilrathi haben geschickt dafür gesorgt, dass die Menschen ihre wahren Absichten und Fähigkeiten unterschätzen. Erst wenige Jahrzehnte sind seit ihrem letzten Krieg gegen die Spezies der Varni vergangen, die vollständig besiegt und versklavt wurde. Nun bereiten sie sich auf den nächsten Angriffskrieg vor, der, wie so oft in ihrer Geschichte, mit dem „Jak-tu“, einem alles entscheidenden Überraschungsschlag beginnen soll. Vor der Menschheit haben sie wenig Respekt, sie gilt in den Augen der Kilrathi als schwach und dekadent. Mit großem Interesse verfolgen sie die unverschlüsselten Übertragungen der Konföderation, während sie selbst nur das nach außen dringen lassen, was sie die Konföderierten wissen lassen wollen. Die Menschheit bekommt lediglich veraltete Schiffe der Kilrathi zu sehen und verfällt dem Trugschluss, sie wäre technologisch im Vorteil. Derweil ist der Krieg für die Katzen längst beschlossene Sache: Ein gewaltiger Erstschlag gegen die Flottenbasis der Siebten Flotte auf und um McAuliffe soll den Krieg schnell entscheiden. Um die Chancen zu erhöhen, wählen die Kilrathi einen Feiertag für ihren Angriff aus: Der „Tag der Konföderation“, an dem die Flotte in allgemeiner Partylaune versinkt, soll den Menschen zum Verhängnis werden. Admiral Banbridge, der dieses Manöver voraussieht, sind jedoch die Hände gebunden. Eine große Mobilmachung der Flotte darf er nicht eigenmächtig befehlen. Ihm bleibt keine andere Wahl, als ein geheimes Kommandounternehmen ins Grenzgebiet zu den Kilrathi zu entsenden, um handfeste Beweise für die Offensive zu sammeln, die die Regierung überzeugen sollen. Das Unternehmen besteht aus drei Männern: Commander Winston Turner, ein ehemaliger Geheimdienstler und nun Professor an der Akademie, Lieutenant Vance Richards, ein Kampfpilot, sowie der frischgebackene Akademieabsolvent Midshipman Geoffrey Tolwyn. In den Randkolonien des Landreichs angekommen, chartern die drei das Schiff eines jungen Privateers und Schmugglers. Der Eigner ist niemand anderes als Hans Kruger (oder Krüger). Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt auf einer Schmuggler-Raumstation der Kilrathi gelangen sie schließlich an die benötigten Informationen, die den bevorstehenden Krieg beweisen. Währenddessen beginnt die Konföderation mit einer halbgaren Bestrafungsaktion gegen Grenzsysteme der Kilrathi. Offiziell herrscht noch kein Kriegszustand, doch die konföderierte Regierung hält diese Aktion für völlig ausreichend.
Turner, Tolwyn und Richards sind mit ihren Daten derweil auf dem Weg nach McAuliffe, um die Erde vor dem bevorstehenden Angriff zu warnen.
"Ich würde immer eine Maschine bevorzugen, die um einen schweren Jäger Kreise fliegen kann, wenn es sein muss.“ Alec "Ninja" Crisologo, Wing Commander Saga
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
9 Jahre 1 Monat her #28680
von Arrow
"Ich würde immer eine Maschine bevorzugen, die um einen schweren Jäger Kreise fliegen kann, wenn es sein muss.“ Alec "Ninja" Crisologo, Wing Commander Saga
Arrow antwortete auf Wing Commander-Romane: Von Freedom Flight bis False Colors
Rezension Teil 1
Damit wären wir etwa bei der Hälfte des Romans angelangt. Schnell wird klar, dass dieser Verlauf der Ereignisse ein wenig von der Chronologie des WC3-Handbuchs „Victory Streak“ abweicht. Dort erklärt die Konföderation den Kilrathi nach dem Abschuss eines zivilen Schiffes den Krieg, während hier nur von einer begrenzten Militäraktion die Rede ist. Der kommende Großangriff auf den Stützpunkt von McAuliffe ist zwar verbürgt, doch weicht der Roman auch hier in zahlreichen Details vom Victory Streak ab. Der Roman lässt den Krieg erst mit der Großoffensive gegen die Basis ausbrechen und wertet die historische Parallele zum japanischen Angriff auf den Flottenstützpunkt Pearl Harbor damit noch einmal gewaltig auf. Allerdings lassen sich diese Abweichungen verschmerzen.
Bisher ist alles sehr spannend geschildert, wobei der Autor die Perspektive zwischen Menschen und Kilrathi immer wieder wechselt. Erneut stellt Forstchen, wie bereits schon zuvor in „Die Geheimflotte“, die konföderierten Politiker als eine Gruppe von naiven Ignoranten dar, deren Karriere ihnen stets wichtiger ist als die Sicherheit der Bevölkerung. Sie stellen die Warnungen der Militärs als Hirngespinste dar und legen ihnen immer wieder Steine in den Weg. So treffen wir hier auf einen Senator, der durch sein stures Veto, die längst notwendige Modernisierung der konföderierten Flotte aus rein wirtschaftlichen Gründen blockiert, sofern die Investitionen eben nicht seinem Planeten zugute kommen. Mit ihren Handlungen stellen sie sich immer wieder gegen die Streitkräfte, sodass man fast den Eindruck bekommt, sie stünden auf der Gehaltsliste der Kilrathi. Andererseits sind die Kilrathi mit ihrer Desinformationstaktik äußerst geschickt, und nach 100 Jahren Frieden darf man zumindest in dieser Ära den Politikern eine gewisse Naivität zubilligen. Dass sie die Warnungen ihres Militärgeheindienstes dennoch derart ignorieren, ist freilich höchst fahrlässig.
Als Folge des langen Friedens steht die terranische Flotte allenfalls auf dem Papier gut da: Zwar macht die Ausrüstungsstärke einen überzeugenden Eindruck, aber das Material ist teilweise hoffnungslos veraltet. Von über dreißig Jahren alten Jägern und Bombern ist hier bisweilen die Rede, doch darf dabei auch nicht vergessen werden, dass 2634 in Punkto Raumkampftaktik noch ganz andere Richtlinien gelten: Trägerschiffe und deren Jägergeschwader gelten hier auf beiden Seiten als nachgeordnete Unterstützungseinheiten für die wahren Schlachtschiffe und Kreuzer. Die alteingesessene Admiralität beider Seiten hält von Trägern nebst Jägern noch relativ wenig und zieht die historisch bewährte Feuerkraft sowie starke Panzerung allen neumodischen Spinnereien vor.
Wie immer vollzieht Forstchen, und Wing Commander generell, die historische Parallele zum See- und Lufkrieg des Zweiten Weltkriegs gegen Japan. Während damals Flugzeugträger und Trägerflugzeuge die schwer gepanzerten Kriegsschiffe allmählich auf den zweiten Rang verwiesen, womit sich ein militärischer Paradigmenwechsel vollzog, so erleben wir in „Die Bedrohung“ eine Neuauflage dieses Zeitenwandels im 27. Jahrhundert. Der Autor ist clever genug, daraus keine allzu simple Wiederholung der Geschichte zu konstruieren, sondern beruft sich auf Konventionen der ersten beiden WC-Spiele. Die Phasen-Schutzschilde der Großkampfschiffe sind demnach so stark, dass Jäger und Bomber diese allenfalls mit konzentriertem Dauerfeuer durchdringen können, während sie selbst vom Flagfeuer zerstört würden. Nur starke Schiffsgeschütze können Kriegsschiffen ernsthaft gefährlich werden. Die Kilrathi wollen bei ihrem Angriff auf die Basis McAuliffe diese taktische Schwäche erstmals durch eine brandneue Waffe aushebeln, nämlich mit einem Flugkörper, der einen Phasenschild durchdringen kann. Der Vorläufer des klassischen Torpedos wird also zum Wegbereiter einer Marinekampftaktik, die in WC zwanzig Jahre später selbstverständlich ist.
Die neuen Torpedos sollen den Kilrathi ermöglichen, die durch einen schweren Schild geschütze McAuliffe-Basis einzunehmen. Die Parallele zum Angriff auf Pearl Harbor drängt sich hier wieder auf, denn auch die Japaner rüsteten ihre Torpedos damals speziell für diesen Angriff nach. Übertreibt es Forstchen mit seinen Parallelen hier vielleicht ein wenig? Ein bisschen schon, finde ich. Musste man denn einem kritischen Kilrathi allen Ernstes die Allegorie vom „schlafenden Riesen“ in den Mund legen, den der Angriff auf die Menschen wecken könnte - eine Aussage, die die Popkultur bis heute dem japanischen Admiral Yamaoto vor seinem Angriff auf die USA (fälschlicherweise) zuschreibt? Hier treibt es Forstchen wirklich etwas zu weit, doch vielleicht sollten wir es der Vermittlungsinstanz des fiktiven Militärhistorikers zuschreiben, der immerhin für ein Publikum des 27. Jahrhunderts schreibt.
Auf der Figurenseite ist die Angelegenheit schnell klar. Wer die früheren Romane kennt, trifft hier einige wichtige Charaktere in ihren jungen Jahren wieder. Da wäre zuerst natürlich Geoffrey Tolwyn selbst. Ein 21-jähriger britischer Bengel aus reicher, adliger Familie, der einmal Kampfpilot werden möchte. Ein vorlauter Kommentar gegenüber einem militärfeindlichen Senator vor laufender Kamera beendet praktisch seine zukünftige Karriere, weshalb er von Admiral Banbridge für die geheime Mission ausgewählt wird. Zwanzig Jahre später wird er schon selbst Admiral sein und zum besten Freund und Vertrauten Banbridges werden. Logischerweise ist er eine der Hauptfiguren des Romans, und er verdient sich hier seine ersten Sporen, doch dazu später mehr.
Lieutenant Vance Richards ist ein junger Kampfpilot und ebenfalls ehemaliger Absolvent der Akademie der Konföderation. Er wird später einmal zum Chef des Nachrichtendienstes der Flotte aufsteigen und im Roman „Die Geheimflotte“ noch eine wichtige Rolle spielen.
Und da wäre natürlich noch Hans Kruger (oder Krüger), der in den chronologisch später angesiedelten Romanen Maximilian Kruger genannt wird, was wohl sein zweiter Vorname ist. Krüger kommt aus den Randkolonien des Landreich-Sektors und wird später einmal die „Freie Republik Landreich“ ausrufen, deren Präsident er wird. In diesem Roman ist auch er 21 Jahre alt, doch als Kolonial-Privateer bereits mit allen Wassern gewaschen. Forstchen führt hier alte Figuren zusammen, um gewisse Beziehungen zu klären, die diese dreißig Jahre später zueinander haben. Er baut auch ziemlich deutlich auf den Wiedererkennungseffekt, womit klar sein dürfte, dass dieser Roman eindeutig für Kenner der früheren Werke konzipiert ist.
Interessant sind vor allem die Szenen, die auf der Schmugglerbasis der Kilrathi stattfinden. Hier zeigt sich sich, dass Schmuggler, Zuhälter, Schwarzmarkthändler und Freibeuter schon längst Kontakt mit den Kilrathi unterhalten. Die Kilrathi dort sind natürlich ausgestoßene, Kriminelle oder Entehrte, doch es herrscht durchaus freier Handel. Zu schade, dass diese Episode ein zu schnelles Ende fand. Noch interessanter sind natürlich die Szenen aufseiten der Kilrathi. Bekannte Figuren wie Thrakhath oder Jukaga sind zu dieser Zeit noch Kinder oder halbe Jugendliche. Hier machen noch deren Väter Politik, wobei der alte Imperator die einzige Konstante darstellt. Die Clan-Konflikte, die wir aus früheren Erzählungen nur zu gut kennen, setzen sich hier fort, wobei die Rollen klar verteilt sind: Der Imperator drängt auf den baldigen Krieg mit den Menschen. Sein Sohn, Kronprinz Gilkarg, ist als Oberbefehlshaber der Streitkräfte dessen rechte Hand und soll den Angriff persönlich anführen. Zum ersten Mal will er die Trägerschiffe zur Hauptwaffe des Angriffs machen, was ihn von allen Seiten Kritik einbringt.
Die "Opposition" kommt natürlich, wie kann es auch anders sein, aus den Reihen des intellektuellen Ki’ra-Clans in Person von Baron Vakka, dem Vater des jungen Jukaga. Seltsamerweise verzichtet der Autor dieses Mal komplett auf alle etablierten Clan-Namen, doch erneut wird die besondere Stellung von Vakka herausgestellt: Der Baron warnt vor einem Angriff auf die Menschen, da er sie als einziger näher studiert hat, ja sogar Bekanntschaften mit ihnen unterhält. In gewisser Hinsicht stellt er hier das Gegenstück zu Admiral Banbridge dar. Beide warnen jeweils vor der Unterschätzung des Gegners. Der Eine möchte die ignoranten Friedenssüchtigen auf seiner Seite bekehren, der Andere die blindwütigen Kriegstreiber auf seiner. Beide werden letztlich scheitern, ihre Lehren aber an ihre (geistigen) Nachkommen weitergeben. Doch die werden sich fortan im Krieg gegenüberstehen.
Die Randkolonien des Landreichs dürfen natürlich nicht fehlen. Schon immer waren diese weitab gelegenen terranischen Welten an der äußersten Grenze der Konföderation das Steckenpferd von Forstchen. Auch wenn deren Unabhängigkeitserklärung und Republikgründung noch lange nicht erfolgt ist, pochen sie hier bereits auf Autonomie und haben sogar einen eigenen (nicht anerkannten) Präsidenten ernannt. Allerdings bricht Forstchen eklatant mit seinen früheren Romanen, wenn er die Landreich-Bewohner plötzlich als Ausländer bezeichnet, die nicht die konföderierte Staatsbürgerschaft besitzen, und die deshalb bei der Aufnahme in die Flottenakademie der Erde diskriminiert werden. Das widerspricht allen früheren Büchern, die das Landreich als Zusammenschluss widerspenstiger Seperatisten schildern, die die konföderierte Autorität (aus durchaus nachvollziehbaren Gründen) ablehnen. Wenn die Konföderation diese Menschen jedoch Jahrzehnte zuvor selbst als Ausländer bezeichnet und ihnen keine Bürgerrechte zugesteht, kann sie deren Unabhängigkeitbestrebungen nun wirklich nicht verurteilen. Die spätere Sezession wäre kein illegaler Akt, sondern auch nach heutigem Völkerrecht vollkommen legitim. Sollte die Konföderation die Landreich-Welten also wie entrechtete Kolonien behandeln, denen man nicht einmal eine Form der politischen Selbstbestimmung zubilligt, wäre sie ein Unrechtsstaat erster Güte! Ich will nicht völlig ausschließen, dass die deutsche Übersetzung hierfür Verantwortlich ist, doch falls ja, könnte der Schaden nicht größer sein. Oder präsentiert uns der Militärhistoriker und fiktive Autor hier etwa eine Verfälschung der Verhältnisse?
Wie bereits erwähnt, stört die geschilderte unsägliche Gutgläubigkeit und Faktenresistenz der konföderierten Politiker in „Die Bedrohung“ unsäglich und wirkt in ihrer Übertriebenheit fast schon absurd. Was im Roman „Die Geheimflotte“ immerhin noch nachvollziehbar schien, da sich die Menschheit dort nach über 30 Jahren Krieg an einen möglichen Frieden klammerte, wirkt hier teilweise bizarr. Und da drängen sich mir folgende Fragen auf: Wie kann es sein, dass die terranische Regierung die feindliche Einnahme von Fawcett’s World und die Versklavung seiner Siedler ignoriert oder, wie angedeutet, sogar vergisst? Da verschwinden auf einmal so viele Menschen, und niemand nimmt Anstoß daran, weil eben gerade Wahlkampf herrscht? Wie kann es sein, dass die konföderierte Regierung zwar Kontakte mit den von den Kilrathi unterworfenen Varni unterhält, sogar Flüchtlinge aufnimmt, aber die Kilrathi immer noch als unbedeutende Raummacht abtut? Wurden die Flüchtlinge denn nie über die militärische Stärke der Kilrathi befragt, zumal dieser Krieg schon viele Jahre zurückliegt? Wieso fragt auch niemand bei den Landreich-Kolonien nach, die über die Kilrathi beinahe mehr wissen als der Flottengeheimdienst auf der Erde? Da fällt eine angrenzende, nachweislich kriegerische Raummacht seit Jahren immer wieder durch unprovozierte Gewaltakte gegen Menschen auf, lehnt jede diplomatische Beziehung ab, und das Politbarometer der Konföderation tendiert bei den anstehenden Wahlen allen Ernstes zur sogenannten Friedenspartei, die das marode Militär noch weiter kaputtsparen will? Wo wir gerade dabei sind: Wenn die Konföderation also einen begrenzten Militärschlag - mit vorheriger Ankündigung, wohlgemerkt(!) -, gegen die Kilrathi durchführt, warum versetzt sie dann noch nicht mal ihre in unmittelbarer Nähe gelegenen Militärbasen in Alarmbereitschaft? Selbst ein tatsächlich drittklassiger Gegner kann schließlich einen Racheakt gegen hilflose Kolonien ausüben. Der Oberbefehlshaber der Raumflotte (Banbridge) muss sich hier jedoch von einem arroganten Senator wie ein dummer Schuljunge abkanzeln, beschimpfen und erpressen lassen. In den USA, an denen sich das politische System der Konföderation orientiert, werden hochrangige Militärs jedenfalls respektvoller behandelt, Vieraugengespräch hin oder her. Dass Politiker bei Forstchen erneut als korrupte Arschlöcher dargestellt werden, denen ohne eigene militärische Erfahrung sicherheitspolitisch nicht über den Weg zu trauen ist, lässt sich nicht mehr ignorieren. Da fragt man sich allmählich, ob hier nicht doch die persönliche Anschauung des Autors durchscheint, oder aber erneut der fiktive Militärautor karrikiert werden soll.
In „Die Bedrohung“ verhält sich die Konföderation jedenfalls sicherheitspolitisch über große Strecken derartig weltfremd, realitätsverweigernd und ignorant, dass fast die Glaubwürdigkeit darunter leidet. Tatsächlich handeln die Kilrathi hier als Einzige so, wie man es erwartet. Dass sie letztlich dabei sind, die Konföderation ebenfalls zu unterschätzen, ist eine interessante Parallele. Spannend und aufschlussreich sind hingegen wie immer die Schilderungen aus dem Imperium. Eine Militärmacht, die seit Jahrhunderten fast ausschließlich aggressiv expandiert, zwingend auf Sklavenarbeit angewiesen ist und über eine unzureichende Infrastruktur verfügt, steht früher oder später vor gewaltigen Problemen, wie Baron Vakka richtig erkannt hat. Die Führungselite, allen voran der Imperator und sein Sohn, wollen davon freilich nichts wissen. Der Baron hat des Weiteren längst begriffen, dass der Krieg vor allem dem Machterhalt des Herrscherclans dient und keineswegs die alternativlose Bestimmung seines Volkes ist, wie man ihnen immer weismachen will. Nach der Vernichtung Kilrahs, 35 Jahre später, wird Thrakhaths Vasall Melek genau diese Gedanken offen aussprechen und von „Korruption“ sowie „Sklaverei der Blutrünstigkeit“ reden. Zu Lebzeiten des Throns gelten derartige Äußerungen noch als verräterisch und eidbrüchig. Vakka kann also lediglich vor dem überstürzten Krieg gegen die Menschen warnen. Innerhalb der absolutistischen Monarchie des Imperiums sind die Möglichkeiten der politischen Opposition extrem beschränkt, vor allem, wenn man als potentieller Thronrivale gilt. Vakkas Befürchtungen werden sich indes bewahrheiten: Die Kilrathi werden mit dem Krieg gegen die Konföderation letztlich den Untergang ihres Imperiums einleiten und erst danach (möglicherweise) die Lehren aus einem kriegerischen Essentialismus ziehen, den ihre frühere Führung noch gezielt propagiert hatte. Es ist bittere Ironie, dass Geoffrey Tolwyn fast vierzig Jahre später selbst jenem Irrglauben verfallen wird. Durch Krieg und eine rassistische, gewaltsame Form der Bestenauslese wollte er in WCIV das Überleben der Menschheit nach Vorbild der Kilrathi sicherstellen. Im Gegensatz zum Imperator musste er seine Kriegspolitik jedoch demokratisch legitimieren lassen, was aber fehlschlug. Bezeichnenderweise wurde ihm diese Gesinnung selbst zum Verhängnis. Der späte Tolwyn ist gewissermaßen die ideologische Antithese zu Baron Vakka, auch wenn beide aus völlig unterschiedlichen Gesellschaften stammen. Nicht so zu werden wie sein Feind ist letzten Endes der Preis der Freiheit. Mit diesem Roman schließt sich also ein für beide Völker verhängnisvoller Kreis. Tolwyn und Baron Vakka nar Ki’ra (sowie später dessen Sohn Jukaga) sind dabei in jeder Hinsicht tragische Figuren.
Bei diesen Überlegungen will ich’s vorerst bewenden lassen. Fortsetzung folgt.
Damit wären wir etwa bei der Hälfte des Romans angelangt. Schnell wird klar, dass dieser Verlauf der Ereignisse ein wenig von der Chronologie des WC3-Handbuchs „Victory Streak“ abweicht. Dort erklärt die Konföderation den Kilrathi nach dem Abschuss eines zivilen Schiffes den Krieg, während hier nur von einer begrenzten Militäraktion die Rede ist. Der kommende Großangriff auf den Stützpunkt von McAuliffe ist zwar verbürgt, doch weicht der Roman auch hier in zahlreichen Details vom Victory Streak ab. Der Roman lässt den Krieg erst mit der Großoffensive gegen die Basis ausbrechen und wertet die historische Parallele zum japanischen Angriff auf den Flottenstützpunkt Pearl Harbor damit noch einmal gewaltig auf. Allerdings lassen sich diese Abweichungen verschmerzen.
Bisher ist alles sehr spannend geschildert, wobei der Autor die Perspektive zwischen Menschen und Kilrathi immer wieder wechselt. Erneut stellt Forstchen, wie bereits schon zuvor in „Die Geheimflotte“, die konföderierten Politiker als eine Gruppe von naiven Ignoranten dar, deren Karriere ihnen stets wichtiger ist als die Sicherheit der Bevölkerung. Sie stellen die Warnungen der Militärs als Hirngespinste dar und legen ihnen immer wieder Steine in den Weg. So treffen wir hier auf einen Senator, der durch sein stures Veto, die längst notwendige Modernisierung der konföderierten Flotte aus rein wirtschaftlichen Gründen blockiert, sofern die Investitionen eben nicht seinem Planeten zugute kommen. Mit ihren Handlungen stellen sie sich immer wieder gegen die Streitkräfte, sodass man fast den Eindruck bekommt, sie stünden auf der Gehaltsliste der Kilrathi. Andererseits sind die Kilrathi mit ihrer Desinformationstaktik äußerst geschickt, und nach 100 Jahren Frieden darf man zumindest in dieser Ära den Politikern eine gewisse Naivität zubilligen. Dass sie die Warnungen ihres Militärgeheindienstes dennoch derart ignorieren, ist freilich höchst fahrlässig.
Als Folge des langen Friedens steht die terranische Flotte allenfalls auf dem Papier gut da: Zwar macht die Ausrüstungsstärke einen überzeugenden Eindruck, aber das Material ist teilweise hoffnungslos veraltet. Von über dreißig Jahren alten Jägern und Bombern ist hier bisweilen die Rede, doch darf dabei auch nicht vergessen werden, dass 2634 in Punkto Raumkampftaktik noch ganz andere Richtlinien gelten: Trägerschiffe und deren Jägergeschwader gelten hier auf beiden Seiten als nachgeordnete Unterstützungseinheiten für die wahren Schlachtschiffe und Kreuzer. Die alteingesessene Admiralität beider Seiten hält von Trägern nebst Jägern noch relativ wenig und zieht die historisch bewährte Feuerkraft sowie starke Panzerung allen neumodischen Spinnereien vor.
Wie immer vollzieht Forstchen, und Wing Commander generell, die historische Parallele zum See- und Lufkrieg des Zweiten Weltkriegs gegen Japan. Während damals Flugzeugträger und Trägerflugzeuge die schwer gepanzerten Kriegsschiffe allmählich auf den zweiten Rang verwiesen, womit sich ein militärischer Paradigmenwechsel vollzog, so erleben wir in „Die Bedrohung“ eine Neuauflage dieses Zeitenwandels im 27. Jahrhundert. Der Autor ist clever genug, daraus keine allzu simple Wiederholung der Geschichte zu konstruieren, sondern beruft sich auf Konventionen der ersten beiden WC-Spiele. Die Phasen-Schutzschilde der Großkampfschiffe sind demnach so stark, dass Jäger und Bomber diese allenfalls mit konzentriertem Dauerfeuer durchdringen können, während sie selbst vom Flagfeuer zerstört würden. Nur starke Schiffsgeschütze können Kriegsschiffen ernsthaft gefährlich werden. Die Kilrathi wollen bei ihrem Angriff auf die Basis McAuliffe diese taktische Schwäche erstmals durch eine brandneue Waffe aushebeln, nämlich mit einem Flugkörper, der einen Phasenschild durchdringen kann. Der Vorläufer des klassischen Torpedos wird also zum Wegbereiter einer Marinekampftaktik, die in WC zwanzig Jahre später selbstverständlich ist.
Die neuen Torpedos sollen den Kilrathi ermöglichen, die durch einen schweren Schild geschütze McAuliffe-Basis einzunehmen. Die Parallele zum Angriff auf Pearl Harbor drängt sich hier wieder auf, denn auch die Japaner rüsteten ihre Torpedos damals speziell für diesen Angriff nach. Übertreibt es Forstchen mit seinen Parallelen hier vielleicht ein wenig? Ein bisschen schon, finde ich. Musste man denn einem kritischen Kilrathi allen Ernstes die Allegorie vom „schlafenden Riesen“ in den Mund legen, den der Angriff auf die Menschen wecken könnte - eine Aussage, die die Popkultur bis heute dem japanischen Admiral Yamaoto vor seinem Angriff auf die USA (fälschlicherweise) zuschreibt? Hier treibt es Forstchen wirklich etwas zu weit, doch vielleicht sollten wir es der Vermittlungsinstanz des fiktiven Militärhistorikers zuschreiben, der immerhin für ein Publikum des 27. Jahrhunderts schreibt.
Auf der Figurenseite ist die Angelegenheit schnell klar. Wer die früheren Romane kennt, trifft hier einige wichtige Charaktere in ihren jungen Jahren wieder. Da wäre zuerst natürlich Geoffrey Tolwyn selbst. Ein 21-jähriger britischer Bengel aus reicher, adliger Familie, der einmal Kampfpilot werden möchte. Ein vorlauter Kommentar gegenüber einem militärfeindlichen Senator vor laufender Kamera beendet praktisch seine zukünftige Karriere, weshalb er von Admiral Banbridge für die geheime Mission ausgewählt wird. Zwanzig Jahre später wird er schon selbst Admiral sein und zum besten Freund und Vertrauten Banbridges werden. Logischerweise ist er eine der Hauptfiguren des Romans, und er verdient sich hier seine ersten Sporen, doch dazu später mehr.
Lieutenant Vance Richards ist ein junger Kampfpilot und ebenfalls ehemaliger Absolvent der Akademie der Konföderation. Er wird später einmal zum Chef des Nachrichtendienstes der Flotte aufsteigen und im Roman „Die Geheimflotte“ noch eine wichtige Rolle spielen.
Und da wäre natürlich noch Hans Kruger (oder Krüger), der in den chronologisch später angesiedelten Romanen Maximilian Kruger genannt wird, was wohl sein zweiter Vorname ist. Krüger kommt aus den Randkolonien des Landreich-Sektors und wird später einmal die „Freie Republik Landreich“ ausrufen, deren Präsident er wird. In diesem Roman ist auch er 21 Jahre alt, doch als Kolonial-Privateer bereits mit allen Wassern gewaschen. Forstchen führt hier alte Figuren zusammen, um gewisse Beziehungen zu klären, die diese dreißig Jahre später zueinander haben. Er baut auch ziemlich deutlich auf den Wiedererkennungseffekt, womit klar sein dürfte, dass dieser Roman eindeutig für Kenner der früheren Werke konzipiert ist.
Interessant sind vor allem die Szenen, die auf der Schmugglerbasis der Kilrathi stattfinden. Hier zeigt sich sich, dass Schmuggler, Zuhälter, Schwarzmarkthändler und Freibeuter schon längst Kontakt mit den Kilrathi unterhalten. Die Kilrathi dort sind natürlich ausgestoßene, Kriminelle oder Entehrte, doch es herrscht durchaus freier Handel. Zu schade, dass diese Episode ein zu schnelles Ende fand. Noch interessanter sind natürlich die Szenen aufseiten der Kilrathi. Bekannte Figuren wie Thrakhath oder Jukaga sind zu dieser Zeit noch Kinder oder halbe Jugendliche. Hier machen noch deren Väter Politik, wobei der alte Imperator die einzige Konstante darstellt. Die Clan-Konflikte, die wir aus früheren Erzählungen nur zu gut kennen, setzen sich hier fort, wobei die Rollen klar verteilt sind: Der Imperator drängt auf den baldigen Krieg mit den Menschen. Sein Sohn, Kronprinz Gilkarg, ist als Oberbefehlshaber der Streitkräfte dessen rechte Hand und soll den Angriff persönlich anführen. Zum ersten Mal will er die Trägerschiffe zur Hauptwaffe des Angriffs machen, was ihn von allen Seiten Kritik einbringt.
Die "Opposition" kommt natürlich, wie kann es auch anders sein, aus den Reihen des intellektuellen Ki’ra-Clans in Person von Baron Vakka, dem Vater des jungen Jukaga. Seltsamerweise verzichtet der Autor dieses Mal komplett auf alle etablierten Clan-Namen, doch erneut wird die besondere Stellung von Vakka herausgestellt: Der Baron warnt vor einem Angriff auf die Menschen, da er sie als einziger näher studiert hat, ja sogar Bekanntschaften mit ihnen unterhält. In gewisser Hinsicht stellt er hier das Gegenstück zu Admiral Banbridge dar. Beide warnen jeweils vor der Unterschätzung des Gegners. Der Eine möchte die ignoranten Friedenssüchtigen auf seiner Seite bekehren, der Andere die blindwütigen Kriegstreiber auf seiner. Beide werden letztlich scheitern, ihre Lehren aber an ihre (geistigen) Nachkommen weitergeben. Doch die werden sich fortan im Krieg gegenüberstehen.
Die Randkolonien des Landreichs dürfen natürlich nicht fehlen. Schon immer waren diese weitab gelegenen terranischen Welten an der äußersten Grenze der Konföderation das Steckenpferd von Forstchen. Auch wenn deren Unabhängigkeitserklärung und Republikgründung noch lange nicht erfolgt ist, pochen sie hier bereits auf Autonomie und haben sogar einen eigenen (nicht anerkannten) Präsidenten ernannt. Allerdings bricht Forstchen eklatant mit seinen früheren Romanen, wenn er die Landreich-Bewohner plötzlich als Ausländer bezeichnet, die nicht die konföderierte Staatsbürgerschaft besitzen, und die deshalb bei der Aufnahme in die Flottenakademie der Erde diskriminiert werden. Das widerspricht allen früheren Büchern, die das Landreich als Zusammenschluss widerspenstiger Seperatisten schildern, die die konföderierte Autorität (aus durchaus nachvollziehbaren Gründen) ablehnen. Wenn die Konföderation diese Menschen jedoch Jahrzehnte zuvor selbst als Ausländer bezeichnet und ihnen keine Bürgerrechte zugesteht, kann sie deren Unabhängigkeitbestrebungen nun wirklich nicht verurteilen. Die spätere Sezession wäre kein illegaler Akt, sondern auch nach heutigem Völkerrecht vollkommen legitim. Sollte die Konföderation die Landreich-Welten also wie entrechtete Kolonien behandeln, denen man nicht einmal eine Form der politischen Selbstbestimmung zubilligt, wäre sie ein Unrechtsstaat erster Güte! Ich will nicht völlig ausschließen, dass die deutsche Übersetzung hierfür Verantwortlich ist, doch falls ja, könnte der Schaden nicht größer sein. Oder präsentiert uns der Militärhistoriker und fiktive Autor hier etwa eine Verfälschung der Verhältnisse?
Wie bereits erwähnt, stört die geschilderte unsägliche Gutgläubigkeit und Faktenresistenz der konföderierten Politiker in „Die Bedrohung“ unsäglich und wirkt in ihrer Übertriebenheit fast schon absurd. Was im Roman „Die Geheimflotte“ immerhin noch nachvollziehbar schien, da sich die Menschheit dort nach über 30 Jahren Krieg an einen möglichen Frieden klammerte, wirkt hier teilweise bizarr. Und da drängen sich mir folgende Fragen auf: Wie kann es sein, dass die terranische Regierung die feindliche Einnahme von Fawcett’s World und die Versklavung seiner Siedler ignoriert oder, wie angedeutet, sogar vergisst? Da verschwinden auf einmal so viele Menschen, und niemand nimmt Anstoß daran, weil eben gerade Wahlkampf herrscht? Wie kann es sein, dass die konföderierte Regierung zwar Kontakte mit den von den Kilrathi unterworfenen Varni unterhält, sogar Flüchtlinge aufnimmt, aber die Kilrathi immer noch als unbedeutende Raummacht abtut? Wurden die Flüchtlinge denn nie über die militärische Stärke der Kilrathi befragt, zumal dieser Krieg schon viele Jahre zurückliegt? Wieso fragt auch niemand bei den Landreich-Kolonien nach, die über die Kilrathi beinahe mehr wissen als der Flottengeheimdienst auf der Erde? Da fällt eine angrenzende, nachweislich kriegerische Raummacht seit Jahren immer wieder durch unprovozierte Gewaltakte gegen Menschen auf, lehnt jede diplomatische Beziehung ab, und das Politbarometer der Konföderation tendiert bei den anstehenden Wahlen allen Ernstes zur sogenannten Friedenspartei, die das marode Militär noch weiter kaputtsparen will? Wo wir gerade dabei sind: Wenn die Konföderation also einen begrenzten Militärschlag - mit vorheriger Ankündigung, wohlgemerkt(!) -, gegen die Kilrathi durchführt, warum versetzt sie dann noch nicht mal ihre in unmittelbarer Nähe gelegenen Militärbasen in Alarmbereitschaft? Selbst ein tatsächlich drittklassiger Gegner kann schließlich einen Racheakt gegen hilflose Kolonien ausüben. Der Oberbefehlshaber der Raumflotte (Banbridge) muss sich hier jedoch von einem arroganten Senator wie ein dummer Schuljunge abkanzeln, beschimpfen und erpressen lassen. In den USA, an denen sich das politische System der Konföderation orientiert, werden hochrangige Militärs jedenfalls respektvoller behandelt, Vieraugengespräch hin oder her. Dass Politiker bei Forstchen erneut als korrupte Arschlöcher dargestellt werden, denen ohne eigene militärische Erfahrung sicherheitspolitisch nicht über den Weg zu trauen ist, lässt sich nicht mehr ignorieren. Da fragt man sich allmählich, ob hier nicht doch die persönliche Anschauung des Autors durchscheint, oder aber erneut der fiktive Militärautor karrikiert werden soll.
In „Die Bedrohung“ verhält sich die Konföderation jedenfalls sicherheitspolitisch über große Strecken derartig weltfremd, realitätsverweigernd und ignorant, dass fast die Glaubwürdigkeit darunter leidet. Tatsächlich handeln die Kilrathi hier als Einzige so, wie man es erwartet. Dass sie letztlich dabei sind, die Konföderation ebenfalls zu unterschätzen, ist eine interessante Parallele. Spannend und aufschlussreich sind hingegen wie immer die Schilderungen aus dem Imperium. Eine Militärmacht, die seit Jahrhunderten fast ausschließlich aggressiv expandiert, zwingend auf Sklavenarbeit angewiesen ist und über eine unzureichende Infrastruktur verfügt, steht früher oder später vor gewaltigen Problemen, wie Baron Vakka richtig erkannt hat. Die Führungselite, allen voran der Imperator und sein Sohn, wollen davon freilich nichts wissen. Der Baron hat des Weiteren längst begriffen, dass der Krieg vor allem dem Machterhalt des Herrscherclans dient und keineswegs die alternativlose Bestimmung seines Volkes ist, wie man ihnen immer weismachen will. Nach der Vernichtung Kilrahs, 35 Jahre später, wird Thrakhaths Vasall Melek genau diese Gedanken offen aussprechen und von „Korruption“ sowie „Sklaverei der Blutrünstigkeit“ reden. Zu Lebzeiten des Throns gelten derartige Äußerungen noch als verräterisch und eidbrüchig. Vakka kann also lediglich vor dem überstürzten Krieg gegen die Menschen warnen. Innerhalb der absolutistischen Monarchie des Imperiums sind die Möglichkeiten der politischen Opposition extrem beschränkt, vor allem, wenn man als potentieller Thronrivale gilt. Vakkas Befürchtungen werden sich indes bewahrheiten: Die Kilrathi werden mit dem Krieg gegen die Konföderation letztlich den Untergang ihres Imperiums einleiten und erst danach (möglicherweise) die Lehren aus einem kriegerischen Essentialismus ziehen, den ihre frühere Führung noch gezielt propagiert hatte. Es ist bittere Ironie, dass Geoffrey Tolwyn fast vierzig Jahre später selbst jenem Irrglauben verfallen wird. Durch Krieg und eine rassistische, gewaltsame Form der Bestenauslese wollte er in WCIV das Überleben der Menschheit nach Vorbild der Kilrathi sicherstellen. Im Gegensatz zum Imperator musste er seine Kriegspolitik jedoch demokratisch legitimieren lassen, was aber fehlschlug. Bezeichnenderweise wurde ihm diese Gesinnung selbst zum Verhängnis. Der späte Tolwyn ist gewissermaßen die ideologische Antithese zu Baron Vakka, auch wenn beide aus völlig unterschiedlichen Gesellschaften stammen. Nicht so zu werden wie sein Feind ist letzten Endes der Preis der Freiheit. Mit diesem Roman schließt sich also ein für beide Völker verhängnisvoller Kreis. Tolwyn und Baron Vakka nar Ki’ra (sowie später dessen Sohn Jukaga) sind dabei in jeder Hinsicht tragische Figuren.
Bei diesen Überlegungen will ich’s vorerst bewenden lassen. Fortsetzung folgt.
"Ich würde immer eine Maschine bevorzugen, die um einen schweren Jäger Kreise fliegen kann, wenn es sein muss.“ Alec "Ninja" Crisologo, Wing Commander Saga
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
9 Jahre 3 Wochen her #28755
von Arrow
"Ich würde immer eine Maschine bevorzugen, die um einen schweren Jäger Kreise fliegen kann, wenn es sein muss.“ Alec "Ninja" Crisologo, Wing Commander Saga
Arrow antwortete auf Wing Commander-Romane: Von Freedom Flight bis False Colors
Willkommen zum 2. Teil der Besprechung des Romans „WC: Die Bedrohung“.
Die Lektüre der zweiten Hälfte hat mir sehr viel Spaß gemacht, und die Seiten sind wie im Flug vergangen. Das liegt vor allem daran, dass sich die Ereignisse nun regelrecht überschlagen, und das hohe Erzähltempo nimmt bis zum Schluss nicht ab. Die bisherige Steigerung muss natürlich nunmehr zum Kilmax führen, und der beginnt kurz nach der Hälfte des Romans. Die Rede ist von der Schlacht um McAuliffe, die dramaturgisch ja nach allen Regeln der Kunst vorbereitet wurde.
Wie zuvor werde ich die Handlung rekapitulieren, um sie daraufhin näher unter die Lupe zu nehmen. Die Spoilerwarnung gilt weiterhin, doch wer dies hier liest, dürfte sowieso „vorbelastet“ sein.
Unsere nunmehr zwei Protagonisten (Kruger wurde im Landreich eingezogen) schaffen es mit ihrem schwer angeschlagenen Privateer-Schiff, der Lazarus, sicher nach McAuliffe. Für Commander Turner ist nun die Rolle der Kassandra vorgesehen. Es ist der „Tag der Konföderation“, und fast die gesamte Flottenbasis befindet sich in einer Mischung aus Feiertagslaune und Alkoholrausch. Der Dienst ist lasch, die Kommandeure haben bereits ihren Kurzurlaub angetreten, und zu allem übel ist die Kommunikationsverbindung zum Oberkommando auf der Erde durch Sonnenstürme lahmgelegt. Turner, Richards und Tolwyn müssen fast im Alleingang die Basis in Alarmbereitschaft versetzen. Das Oberkommando ist indes von einem Angriff auf McAuliffe überzeugt, da man eine abgefangene Übertragung teilweise dechiffrieren konnte. Der Mobilisierungsbefehl per Kurier blieb allerdings aufgrund des Feiertags irgendwo in der Verwaltung ungelesen liegen. Bis die Funkverbindung zur Erde wiederhergestellt und die Basis halbwegs mobilisiert ist, vergeht wertvolle Zeit. Schließlich schlägt die Jumppoint-Wache des Systems Alarm, und die Kilrathi beginnen ihren Angriffsflug. Auf der Basis McAuliffe bricht zwar erst mal das Chaos aus, doch grundsätzlich fühlt man sich relativ sicher: Die Planetenbasis sowie der Orbitalstützpunkt mit der angedockten Flotte sind durch einen starken Phasenschild geschützt; Schlachtschiffe benötigen des Weiteren vier Stunden bis zum Planeten. Doch weit gefehlt: dieser Angriff erfolgt durch Träger und Bomber, die viel schneller am Ziel sind. In kurzer Zeit versucht man, die Schiffe zu bemannen, die erst mühselig ihre Reaktoren hochfahren müssen. Winston Turner fliegt mit der Lazarus sowie mit so vielen Kampfpiloten an Bord wie möglich zum einzigen Flottenträger im Orbit, der Concordia, dem Vorgängerschiff des bekannten Trägers. An Bord angekommen, übernimmt er, da fast alle Offiziere abwesend sind, das Kommando. Das Geschwader der Concordia ist nicht mal zur Hälfte einsatzfähig, doch die Piloten werden umgehend auf Hunderte feindlicher Bomber angesetzt, die sich nun mit ihren neuen Torpedos auf die Basis stürzen.
Kronprinz Gilkarg konnte sich mit seinem neuen Angriffsplan durchsetzen: Zum ersten Mal führen Trägerschiffe mit ihren Bombern einen Großangriff aus, während die Schlachtschiffe in der zweiten Reihe sitzen. Fünf Träger, acht Schlachtschiffe sowie Dutzende Geleitschiffe sind im System. Die erste Phase des Überraschungsangriffs gelingt. Die neuen Torpedos durchdringen den Schild der Basis und zerstören alle Schildgeneratoren auf McAuliffe. Das Wahrzeichen von McAuliffe, der "Skyhook-Tower", der den Planeten mit der großen Raumbasis verbindet, wird zertrümmert. Ein Großteil der dort angedockten Flotte kann sich nicht rechtzeitig freimachen und stürzt ins Verderben. Nur wenigen Schiffen gelingt es sich zu formieren, darunter die Concordia. Doch auch der Träger wird angegriffen. Geoffrey Tolwyn fliegt seinen ersten Kampfeinsatz an der Seite von Vance Richards in einer Wildcat, dem Abfangjäger seiner Zeit. Die Concordia muss schwere Treffer einstecken und wird beinahe zerstört, kann sich jedoch vom Planeten und der feindlichen Streitmacht absetzen. Nur wenige Schiffe sind an ihrer Seite, und man zieht sich erst einmal zurück. Derweil trifft von der Erde eine eher schwächliche Kampfgruppe zur Verstärkung ein, die sich mit Turners Flottille vereint. Zwei Schlachtschiffe befinden sich darunter, doch immerhin ein weiterer Flottenträger, die Ark Royal. Was tun? Den Rückzug antreten oder zurück zum Planeten fliegen, wo die Kilrathi dabei sind, alles kurz und klein zu bombardieren? Turner befiehlt einen waghalsigen Großangriff mit Jägern, Bombern und Kriegsschiffen. Während die Bomber die Kilrathi-Träger ins Visier nehmen, sollen die Jägerstaffeln eine Art Sturzkampf-Angriff auf die Landungsschiffe in der Atmosphäre de Planeten durchführen. Die Chancen stehen denkbar schlecht, denn die Kilrathi sind sechs zu eins überlegen. Turner will die Kilrathi daher austricksen und die Kräfte im letzten Augenblick aufteilen. Zwei Fregatten sollen zusätzlich einen Träger der Kilrathi rammen.
Das Manöver gelingt, der feindliche Träger wird zerstört, während die Abfangjäger die Kilrathi-Truppen in der Luft reihenweise abschießen. Nun beginnt der Rückzug: Die Concordia und ihre Geleitschiffe schlagen sich mit Höchstgeschwindigkeit zum nächsten Jumppoint durch, Kilrathi-Jäger und Bomber dicht im Nacken. Die Verluste sind hoch, doch der rettende Sprung aus dem System gelingt. Derweil erfährt der Imperator auf Kilrah von den eigenen hohen Verlusten (6 Legionen!), darunter viele Angehörige seines Clans, und lässt den Angriff schließlich abbrechen. McAuliffe ist zwar schwer verwüstet, kann von den Menschen jedoch gehalten werden. Der Überraschungsangriff ist mehr oder weniger geglückt, doch die Kilrathi haben einen so hohen Blutzoll entrichtet, dass man kaum von einem Sieg sprechen kann. Der Epilog des Romans spricht von gewaltigen terranischen Gebietsverlusten nach dreißig Tagen Krieg, doch die Konföderation ist politisch geeint wie nie und rüstet militärisch mächtig auf. Der Krieg geht erst los...
Die Lektüre der zweiten Hälfte hat mir sehr viel Spaß gemacht, und die Seiten sind wie im Flug vergangen. Das liegt vor allem daran, dass sich die Ereignisse nun regelrecht überschlagen, und das hohe Erzähltempo nimmt bis zum Schluss nicht ab. Die bisherige Steigerung muss natürlich nunmehr zum Kilmax führen, und der beginnt kurz nach der Hälfte des Romans. Die Rede ist von der Schlacht um McAuliffe, die dramaturgisch ja nach allen Regeln der Kunst vorbereitet wurde.
Wie zuvor werde ich die Handlung rekapitulieren, um sie daraufhin näher unter die Lupe zu nehmen. Die Spoilerwarnung gilt weiterhin, doch wer dies hier liest, dürfte sowieso „vorbelastet“ sein.
Unsere nunmehr zwei Protagonisten (Kruger wurde im Landreich eingezogen) schaffen es mit ihrem schwer angeschlagenen Privateer-Schiff, der Lazarus, sicher nach McAuliffe. Für Commander Turner ist nun die Rolle der Kassandra vorgesehen. Es ist der „Tag der Konföderation“, und fast die gesamte Flottenbasis befindet sich in einer Mischung aus Feiertagslaune und Alkoholrausch. Der Dienst ist lasch, die Kommandeure haben bereits ihren Kurzurlaub angetreten, und zu allem übel ist die Kommunikationsverbindung zum Oberkommando auf der Erde durch Sonnenstürme lahmgelegt. Turner, Richards und Tolwyn müssen fast im Alleingang die Basis in Alarmbereitschaft versetzen. Das Oberkommando ist indes von einem Angriff auf McAuliffe überzeugt, da man eine abgefangene Übertragung teilweise dechiffrieren konnte. Der Mobilisierungsbefehl per Kurier blieb allerdings aufgrund des Feiertags irgendwo in der Verwaltung ungelesen liegen. Bis die Funkverbindung zur Erde wiederhergestellt und die Basis halbwegs mobilisiert ist, vergeht wertvolle Zeit. Schließlich schlägt die Jumppoint-Wache des Systems Alarm, und die Kilrathi beginnen ihren Angriffsflug. Auf der Basis McAuliffe bricht zwar erst mal das Chaos aus, doch grundsätzlich fühlt man sich relativ sicher: Die Planetenbasis sowie der Orbitalstützpunkt mit der angedockten Flotte sind durch einen starken Phasenschild geschützt; Schlachtschiffe benötigen des Weiteren vier Stunden bis zum Planeten. Doch weit gefehlt: dieser Angriff erfolgt durch Träger und Bomber, die viel schneller am Ziel sind. In kurzer Zeit versucht man, die Schiffe zu bemannen, die erst mühselig ihre Reaktoren hochfahren müssen. Winston Turner fliegt mit der Lazarus sowie mit so vielen Kampfpiloten an Bord wie möglich zum einzigen Flottenträger im Orbit, der Concordia, dem Vorgängerschiff des bekannten Trägers. An Bord angekommen, übernimmt er, da fast alle Offiziere abwesend sind, das Kommando. Das Geschwader der Concordia ist nicht mal zur Hälfte einsatzfähig, doch die Piloten werden umgehend auf Hunderte feindlicher Bomber angesetzt, die sich nun mit ihren neuen Torpedos auf die Basis stürzen.
Kronprinz Gilkarg konnte sich mit seinem neuen Angriffsplan durchsetzen: Zum ersten Mal führen Trägerschiffe mit ihren Bombern einen Großangriff aus, während die Schlachtschiffe in der zweiten Reihe sitzen. Fünf Träger, acht Schlachtschiffe sowie Dutzende Geleitschiffe sind im System. Die erste Phase des Überraschungsangriffs gelingt. Die neuen Torpedos durchdringen den Schild der Basis und zerstören alle Schildgeneratoren auf McAuliffe. Das Wahrzeichen von McAuliffe, der "Skyhook-Tower", der den Planeten mit der großen Raumbasis verbindet, wird zertrümmert. Ein Großteil der dort angedockten Flotte kann sich nicht rechtzeitig freimachen und stürzt ins Verderben. Nur wenigen Schiffen gelingt es sich zu formieren, darunter die Concordia. Doch auch der Träger wird angegriffen. Geoffrey Tolwyn fliegt seinen ersten Kampfeinsatz an der Seite von Vance Richards in einer Wildcat, dem Abfangjäger seiner Zeit. Die Concordia muss schwere Treffer einstecken und wird beinahe zerstört, kann sich jedoch vom Planeten und der feindlichen Streitmacht absetzen. Nur wenige Schiffe sind an ihrer Seite, und man zieht sich erst einmal zurück. Derweil trifft von der Erde eine eher schwächliche Kampfgruppe zur Verstärkung ein, die sich mit Turners Flottille vereint. Zwei Schlachtschiffe befinden sich darunter, doch immerhin ein weiterer Flottenträger, die Ark Royal. Was tun? Den Rückzug antreten oder zurück zum Planeten fliegen, wo die Kilrathi dabei sind, alles kurz und klein zu bombardieren? Turner befiehlt einen waghalsigen Großangriff mit Jägern, Bombern und Kriegsschiffen. Während die Bomber die Kilrathi-Träger ins Visier nehmen, sollen die Jägerstaffeln eine Art Sturzkampf-Angriff auf die Landungsschiffe in der Atmosphäre de Planeten durchführen. Die Chancen stehen denkbar schlecht, denn die Kilrathi sind sechs zu eins überlegen. Turner will die Kilrathi daher austricksen und die Kräfte im letzten Augenblick aufteilen. Zwei Fregatten sollen zusätzlich einen Träger der Kilrathi rammen.
Das Manöver gelingt, der feindliche Träger wird zerstört, während die Abfangjäger die Kilrathi-Truppen in der Luft reihenweise abschießen. Nun beginnt der Rückzug: Die Concordia und ihre Geleitschiffe schlagen sich mit Höchstgeschwindigkeit zum nächsten Jumppoint durch, Kilrathi-Jäger und Bomber dicht im Nacken. Die Verluste sind hoch, doch der rettende Sprung aus dem System gelingt. Derweil erfährt der Imperator auf Kilrah von den eigenen hohen Verlusten (6 Legionen!), darunter viele Angehörige seines Clans, und lässt den Angriff schließlich abbrechen. McAuliffe ist zwar schwer verwüstet, kann von den Menschen jedoch gehalten werden. Der Überraschungsangriff ist mehr oder weniger geglückt, doch die Kilrathi haben einen so hohen Blutzoll entrichtet, dass man kaum von einem Sieg sprechen kann. Der Epilog des Romans spricht von gewaltigen terranischen Gebietsverlusten nach dreißig Tagen Krieg, doch die Konföderation ist politisch geeint wie nie und rüstet militärisch mächtig auf. Der Krieg geht erst los...
"Ich würde immer eine Maschine bevorzugen, die um einen schweren Jäger Kreise fliegen kann, wenn es sein muss.“ Alec "Ninja" Crisologo, Wing Commander Saga
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
9 Jahre 3 Wochen her #28757
von Arrow
"Ich würde immer eine Maschine bevorzugen, die um einen schweren Jäger Kreise fliegen kann, wenn es sein muss.“ Alec "Ninja" Crisologo, Wing Commander Saga
Arrow antwortete auf Wing Commander-Romane: Von Freedom Flight bis False Colors
Besprechung
Mit dem Ende des Romans „Die Bedrohung“ sind die Weichen für den weiteren Kriegsverlauf sowie alle kommenden Spiele und Bücher nunmehr gestellt. Auch in Punkto Figuren schließt der Autor den Kreis und lässt es sich nicht nehmen, deren weiteren Werdegang vorwegzunehmen. Der frisch beförderte Geoffrey Tolwyn schlägt ganz zum Schluss einen Posten als Staffelführer aus, um stattdessen das Kommando über eine Fregatte anzutreten. Ob er jemals wieder in ein Cockpit steigen wird, bleibt ungewiss; zwanzig Jahre später wird er bereits Konteradmiral sein. Vance Richards wird indes Wing Commander auf der Ark Royal, später aber ebenfalls eine Kommandolaufbahn in der Flotte einschlagen. Hans Krüger erleidet hinter den feindlichen Linien eine Bruchlandung auf Fawcett’s World und läuft sich schon für seine Karriere als Guerillakämpfer und Kriegsheld des Landreichs warm. Die alte Concordia wurde so schwer beschädigt, dass sie aufgegeben werden muss, doch wird bereits eine Nachfolgerin in Aussicht gestellt, ebenso wie ein möglicher Kommandant namens Tolwyn.
Bei den Kilrathi sind die späteren Konstellationen auch schon abzusehen: Kronprinz Gilkarg hat in der Schlacht seinen Erstgeborenen verloren, sodass der junge Thrakhath an dessen Stelle tritt, während Vakkas Sohn Jukaga sein Studium der Menschen aufnimmt und somit ebenfalls in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Die Rivalität der beiden nobelsten Adelsfamilien des Imperiums geht damit in die nächste Generation ... Kenner der Spiele und Romane wissen, wie es ausgehen wird.
Die zweite Romanhälfte wird von Kämpfen und Flottenbewegungen dominiert, wie es natürlich zu erwarten war. Für größere Auslassungen oder Zeitsprünge – wie noch während der Episode auf der Schmugglerbasis, die leider eine Art Fragment bleibt, – ist hier natürlich kein Platz mehr, denn die Ereignisse überschlagen sich. Das Erzähltempo ist auffällig höher als noch in der ersten Hälfte, und es wird deutlich, wie behutsam und umfänglich der Autor den Beginn des Kriegsausbruchs über McAuliffe vorbereitet (hat). Das gemächliche Tempo der ersten Hälfte erklärt auch den um bis zu 50% größeren Seitenumfang von „Die Bedrohung“ im Vergleich zu den recht dünnen Vorgängern „Die Geheimflotte“ oder „Der Hinterhalt“, die keinesfalls weniger Nebenhandlungen, Schauplätze oder Figuren enthalten bzw. behandeln. Dazu später mehr.
Bei den Kampfhandlungen in - und außerhalb der Cockpits gibt sich der Autor keine Blöße und liefert wie gewohnt gute Qualität. Sowohl kleine als auch große Tragödien spielen sich ab, und die völlige Unvorhersehbarkeit einer Schlacht wird für beide Seiten überdeutlich. Die alte Weisheit, wonach kein Schlachtplan den ersten Schuss überlebt, bewahrheitet sich auch diesmal auf sämtlichen Ebenen. Die Konföderation zahlt einen hohen Preis für die Ignoranz ihrer Regierung, die die Kilrathi sträflich unterschätzt hat. Die Kilrathi wiederum unterschätzen ihren Gegner ebenfalls und können ihre hochgesteckten Ziele nicht annähernd erreichen. Die ersten Kampfeinsätze von Geoffrey Tolwyn werden spannend geschildert und spiegeln Willkür und Zufall des Kriegs en detail wider. Obwohl Tolwyn den Kampf bislang nur vom Flugsimulator her kannte, überlebt er seine ersten Flüge, während viele erfahrenere Piloten fallen.
Die unterschiedliche Mentalität der beiden Fraktionen wird erneut unterstrichen: Die Terraner überwinden ihren anfänglichen Schock schnell und reagieren mit einem verzweifelten, aber knallhart kalkulierten Gegenangriff. Die Kilrathi-Kommandeure, allen voran Kronprinz Gilkarg, sind vom unerwarteten Mut der Menschen zwar durchaus überrascht, erwarten jedoch einen reinen Selbstmordangriff, wie es ihrer eigenen Vorgehensweise entspricht. Solche Fehleinschätzungen mögen bei der ersten Schlacht noch angehen, zumal es die Kilrathi nie nötig hatten, sich mit den Kampftaktiken eines Feindes näher zu befassen, doch auch dreißig Kriegsjahre später werden sie immer noch Opfer derartiger schwerer Irrtümer aufgrund der eigenen Engstirnigkeit und Arroganz. Der sinnlose Selbstmord von Prinz Ratha zeigt das gleiche Missverständnis auf, wenn auch bei komplett invertierter Situation: Nachdem er ausgestiegen ist, missdeutet er Tolwyns respektvollen Salut als Geste der Verhöhnung, die er nicht ertragen kann, und öffnet daraufhin seinen Helm. Die Kilrathi-Führung wird im Verlauf des gesamten Krieges nie lernen, dass die Menschen ihr Leben im Kampf nie blindwütig oder aus Gründen der Ehre opfern, sondern wenn dann stets kalkuliert und aus taktischen Gründen. Die größere strategische Flexibilität der Konföderation wird die Kilrathi immer wieder teuer zu stehen kommen, ja ihnen trotz aller Überlegenheit den Sieg kosten. Am Ende des Romans bricht der Imperator aufgrund der hohen Verluste unter den Landungstruppen die ganze Operation ab, obwohl die terranische Flotte zu diesem Zeitpunkt gar nicht in der Lage ist, zeitnah einen größeren Gegenschlag durchzuführen - und der Planet quasi auf dem Silbertablett liegt. Die Befürchtung, weitere Angehörige seines Clans zu verlieren, überwiegt die strategische Vernunft, McAuliffe zu besetzen. So bleibt die Basis letztlich weiterhin in konföderierter Hand.
Der Epilog des Romans macht deutlich, welcher Hybris die Kilrathi aufgesessen sind, als sie glaubten, den Krieg mit einem Überraschungsschlag schnell entscheiden zu können. Trotz des Verlustes von 70% der Flotte sowie 150 Systeme geht die Konföderation vereinigt in den Krieg und wird von nun an 35 Jahre lang erbitterten Widerstand leisten. Die anfangs noch antimilitärisch eingestellten Politiker erweisen sich schließlich als Heuchler, allen voran Senator More, der nun zum unerbittlichen Kriegsbefürworter mutiert. Dennoch stellt der Autor die Stärke einer Demokratie in den Vordergrund, wenn er Commander Turner zum Schluss dozieren lässt, dass die guten Politiker sich letztlich doch stets durchsetzen würden. Im Falle von Wing Commander geschieht das jedoch meist erst hinterher bzw. viel zu spät! Vor der Schlacht um die Erde in „Die Geheimflotte“ war jedenfalls ein ähnliches politisches Versagen zu beobachten, und man muss ehrlicherweise auch der Menschheit attestieren, aus ihren Fehlern einfach nicht die richtigen Lehren zu ziehen. Dass die klugen Mahner oftmals überstimmt werden, hat in der Politkk zweifellos eine lange Tradition. Chapeau, Herr Autor!
Dass der aufmerksamen Leser in „Die Bedrohung“ so manches Déjà-vu erlebt, ist allerdings nicht die Ausnahme, sondern vielmehr Programm. Alle militärhistorischen Parallelen können nicht kaschieren, dass William Forstchens fünfter WC-Roman auf bewährte, wenn auch längst bekannte Zutaten setzt. In Punkto Handlung setzt der Autor auf strukturelle Versatzsstücke, Elemente und Szenarien, die uns aus den vorherigen Romanen mittlerweile vertraut sind. Da lässt sich einiges aufzählen:
Ein militärisches Kommandounternehmen, das einen bevorstehenden Großangriff der Kilrathi nachweisen soll (Die Geheimflotte), die Realitätsverweigerung einer Zivilregierung, die solch ein Unternehmen notwendig macht (ebenso), die Unterstützung des Landreichs, das die Gefahr längst gerochen hat, und seine Hilfe anbietet (ebenso), junge Offiziere, die mit einem Himmelfahrtskommando konfrontiert sind und letztlich über sich selbst hinauswachsen (Der Hinterhalt), ein Angriff auf eine Landungsoperation der Kilrathi (ebenso), die Flucht bzw. der Abwehrkampf gegen eine Übermacht Kilrathi-Verfolger (Der Hinterhalt, Die Geheimflotte), die Übertölpelung der Kilrathi durch eine verzweifelte Kriegslist (ebenso beide), der heldenhafte Freitod zum Wohle der Konföderation (beide), politischer Disput zwischen Kiranka-Clan und Ki’ra-Clan, wobei der Herrscherclan falsch entscheidet (ebenso beide), große Verluste sowie Wut auf die politische Führung, ohne dass sich etwas ändert (beide) ...
Die Liste könnte man erweitern, keine Frage. Nichts, das wir nicht in irgendeiner Form schon einmal gelesen hätten. Als nachgereichtes Prequel, welches gewissen historischen Vorgaben zu folgen hat (s. Victory Streak), kann man dies freilich akzeptieren, doch spätestens jetzt wird mehr als deutlich, dass Forstchen alten Wein in neuen Schläuchen ausschenkt. Sollte er sich irgendwann dazu entschließen, die Reihe fortzusetzen, wären dringend ein paar neue Ideen vonnöten. Andrew Keiths „False Colors“ schlug durchaus die passende Richtung ein, doch spielt dieser Roman auch nach dem Krieg und hat damit schon automatisch ein anderes Grundszenario. „Die Bedrohung“ jedoch verfrachtet vertraute Handlungsmuster mit freilich vielen Änderungen zwei (je nach Spiel und Buch auch drei) Jahrzehnte in die Vergangenheit und zeigt uns die Figuren der vorherigen Generation. Spannend und interessant, keine Frage, doch bis auf die Verlagerung der Raumkampftaktik hin zu Jägern und Bombern geschieht nichts, das mit einigen Modifikationen nicht auch in einer anderen Phase des langen Krieges zwischen Menschen und Kilrathi vorstellbar wäre.
Fazit
Der Kriegsanfang wurde nun gekonnt in Szene gesetzt, und wir haben erfahren, welche Rolle Tolwyn dabei gespielt hat. Der fiktive Autor – wir erinnern uns an die Rahmenerzählung des Militärhistorikers – hat dem jungen Geoffrey Tolwyn hiermit ein literarisches Denkmal gesetzt. Auf die Frage, wie Tolwyn Jahrzehnte später zum Kriegstreiber und Massenmörder wurde, kann „Die Bedrohung“ jedoch keine Antwort oder Erklärungshilfe liefern. Turner schärft Tolwyn am Ende ein, dass der Dienst an der Menschheit dessen höchste Pflicht sei. Lange Zeit hat Tolwyn diesem Eid alle Ehre erwiesen. Die spätere Entwicklung zum Faschisten, der grauenhafte Selektions-Biowaffen gegen Menschen einsetzt, findet in „Die Bedrohung“ nicht den geringsten Ausgangspunkt. Die Ursache dieses fatalen Gesinnungswandels ist nicht während des Kriegsanfangs zu suchen, sondern allenfalls 30 schreckliche Jahre später. Der Jahrzehnte andauernde Krieg war es, der Tolwyn so furchtbar verändert hat, nicht die früheren Erlebnisse. Keiths „False Colors“ lehrt uns mit seinen wenigen inneren Monologen weitaus mehr über die Gesinnnung Geoffrey Tolwyns als „Die Bedrohung“. Hier wird allenfalls seine Entwicklung zum Kriegshelden vorgezeichnet, mehr aber nicht.
Eine Frage muss noch beantwortet werden: Eignet sich „Actions Stations“ (Die Bedrohung) zum Einstieg in die Lektüre der Romanreihe oder gar der Spielreihe? Meines Erachtens nicht. Der Roman setzt dafür viel zu sehr auf die Leserkenntnisse von etablierten Figuren sowie dem Kriegsausgang. Die Leser sollen bekannte Figuren als junge Personen agieren sehen und deren spätere (Kriegs-)Karrieren rückwirkend im jeweiligen Anfangsstadium erleben. Der Roman möchte rückwirkend einen Kreis schließen und keineswegs einen Anfangspunkt setzen. Bereits die Konstruktion eines fiktiven Autors, der nach dem Krieg aus Gründen historischer Aufklärungsarbeit schreibt, unterstreicht den Status eines nachgereichten Prequels für uns reelle Leser sowie Kenner der Materie. Trotz der historischen Verortung am Anfang der Wing Commander-Chronologie eignet sich „Die Bedrohung“ daher eher schlecht als Einstieg in die Bücher. Mit zwanzig Jahren Zeitdifferenz zu den Ereignissen des ersten Spiels kann von einer echten Kontinuität ohnehin keine Rede sein. Hätte sich der Autor zuvor in diesem (schwarzen) Zeitrahmen betätigt, sähe die Sache etwas anders aus. So bleibt der Roman ein einmaliger Blick auf historische Ereignisse – er beginnt nichts neu, sondern wirft einen detaillierten Blick auf die Anfänge.
Empfehle ich „Die Bedrohung“ trotz seiner Schwächen? Durchaus. Es ist nicht der beste Roman und ganz sicher nicht der notwendigste, doch Kenner und Fans der anderen Bücher kommen daran nicht vorbei. Jawohl, Kenner – dieses Buch richtet sich ganz klar an eingeweihte Leser und Spieler, die einen Blick zurück auf den Beginn des Krieges werfen wollen. Muss man ihn aber unbedingt gelesen haben? Nein, denn „Der Hinterhalt“ und „Die Geheimflotte“ bleiben weiterhin Forstchens unangefochtene Kernwerke, die die Spielserie nicht nur wertvoll ergänzen, sondern in vieler Hinsicht erst glaubwürdig zusammenbinden. „Actions Stations“ steht hier klar außen vor, da es sich historisch an den Anfang setzt, ohne die Geschichte neu erzählen zu wollen. Im Filmgeschäft sind Prequels oft das Ergebnis von Ideenlosigkeit und Geldschneiderei, doch Forstchen muss man immerhin zugute halten, einen großen Bogen schlagen zu wollen. Das ist ihm größtenteils geglückt, wenn auch nicht ohne Fehler. Sollten sich die vielen kleineren und größeren Ungereimtheiten und Widersprüche zu seinen anderen Büchern nicht mit der schlechten Übersetzung ins Deutsche (und einem saumäßigen Lektorat) erklären lassen, muss man ihm ernsthafte Schlampigkeit vorwerfen. Die erste Hälfte ließ mich daher fast auf einen Ghostwriter tippen - ein Verdacht, den ich nebenbei bemerkt nie vollständig losgeworden bin. Beweisen kann ich das freilich nicht, da sei die deutsche Übersetzung vor, doch ein komischer Beigeschmack bleibt.
Wer den Roman auslässt, verpasst also relativ wenig. Neue Ideen finden sich hier jedenfalls nur wenige, doch bleibt der Roman ein fester Bestandteil der WC-Chronologie, die in WCIII festgeschrieben wurde. Dennoch gibt es einfach wichtigere Wing Commander-Bücher, und wer diese bereits im Regal stehen hat, sollte auch für „Die Bedrohung“ ein Plätzchen freimachen können. Als zuletzt erschienenes WC-Buch ist es zurzeit gebraucht besonders günstig zu erwerben und wird in der Regel für lächerliche Cent-Beträge verramscht. Wer es noch nicht hat, sollte also aus Prinzip zugreifen. Bei „False Colors“ ist das bei weitem nicht so einfach wie hier!
Meine Bewertung auf einer Skala, falls unbedingt gewünscht: Sechs von zehn Punkten.
Mit dem Ende des Romans „Die Bedrohung“ sind die Weichen für den weiteren Kriegsverlauf sowie alle kommenden Spiele und Bücher nunmehr gestellt. Auch in Punkto Figuren schließt der Autor den Kreis und lässt es sich nicht nehmen, deren weiteren Werdegang vorwegzunehmen. Der frisch beförderte Geoffrey Tolwyn schlägt ganz zum Schluss einen Posten als Staffelführer aus, um stattdessen das Kommando über eine Fregatte anzutreten. Ob er jemals wieder in ein Cockpit steigen wird, bleibt ungewiss; zwanzig Jahre später wird er bereits Konteradmiral sein. Vance Richards wird indes Wing Commander auf der Ark Royal, später aber ebenfalls eine Kommandolaufbahn in der Flotte einschlagen. Hans Krüger erleidet hinter den feindlichen Linien eine Bruchlandung auf Fawcett’s World und läuft sich schon für seine Karriere als Guerillakämpfer und Kriegsheld des Landreichs warm. Die alte Concordia wurde so schwer beschädigt, dass sie aufgegeben werden muss, doch wird bereits eine Nachfolgerin in Aussicht gestellt, ebenso wie ein möglicher Kommandant namens Tolwyn.
Bei den Kilrathi sind die späteren Konstellationen auch schon abzusehen: Kronprinz Gilkarg hat in der Schlacht seinen Erstgeborenen verloren, sodass der junge Thrakhath an dessen Stelle tritt, während Vakkas Sohn Jukaga sein Studium der Menschen aufnimmt und somit ebenfalls in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Die Rivalität der beiden nobelsten Adelsfamilien des Imperiums geht damit in die nächste Generation ... Kenner der Spiele und Romane wissen, wie es ausgehen wird.
Die zweite Romanhälfte wird von Kämpfen und Flottenbewegungen dominiert, wie es natürlich zu erwarten war. Für größere Auslassungen oder Zeitsprünge – wie noch während der Episode auf der Schmugglerbasis, die leider eine Art Fragment bleibt, – ist hier natürlich kein Platz mehr, denn die Ereignisse überschlagen sich. Das Erzähltempo ist auffällig höher als noch in der ersten Hälfte, und es wird deutlich, wie behutsam und umfänglich der Autor den Beginn des Kriegsausbruchs über McAuliffe vorbereitet (hat). Das gemächliche Tempo der ersten Hälfte erklärt auch den um bis zu 50% größeren Seitenumfang von „Die Bedrohung“ im Vergleich zu den recht dünnen Vorgängern „Die Geheimflotte“ oder „Der Hinterhalt“, die keinesfalls weniger Nebenhandlungen, Schauplätze oder Figuren enthalten bzw. behandeln. Dazu später mehr.
Bei den Kampfhandlungen in - und außerhalb der Cockpits gibt sich der Autor keine Blöße und liefert wie gewohnt gute Qualität. Sowohl kleine als auch große Tragödien spielen sich ab, und die völlige Unvorhersehbarkeit einer Schlacht wird für beide Seiten überdeutlich. Die alte Weisheit, wonach kein Schlachtplan den ersten Schuss überlebt, bewahrheitet sich auch diesmal auf sämtlichen Ebenen. Die Konföderation zahlt einen hohen Preis für die Ignoranz ihrer Regierung, die die Kilrathi sträflich unterschätzt hat. Die Kilrathi wiederum unterschätzen ihren Gegner ebenfalls und können ihre hochgesteckten Ziele nicht annähernd erreichen. Die ersten Kampfeinsätze von Geoffrey Tolwyn werden spannend geschildert und spiegeln Willkür und Zufall des Kriegs en detail wider. Obwohl Tolwyn den Kampf bislang nur vom Flugsimulator her kannte, überlebt er seine ersten Flüge, während viele erfahrenere Piloten fallen.
Die unterschiedliche Mentalität der beiden Fraktionen wird erneut unterstrichen: Die Terraner überwinden ihren anfänglichen Schock schnell und reagieren mit einem verzweifelten, aber knallhart kalkulierten Gegenangriff. Die Kilrathi-Kommandeure, allen voran Kronprinz Gilkarg, sind vom unerwarteten Mut der Menschen zwar durchaus überrascht, erwarten jedoch einen reinen Selbstmordangriff, wie es ihrer eigenen Vorgehensweise entspricht. Solche Fehleinschätzungen mögen bei der ersten Schlacht noch angehen, zumal es die Kilrathi nie nötig hatten, sich mit den Kampftaktiken eines Feindes näher zu befassen, doch auch dreißig Kriegsjahre später werden sie immer noch Opfer derartiger schwerer Irrtümer aufgrund der eigenen Engstirnigkeit und Arroganz. Der sinnlose Selbstmord von Prinz Ratha zeigt das gleiche Missverständnis auf, wenn auch bei komplett invertierter Situation: Nachdem er ausgestiegen ist, missdeutet er Tolwyns respektvollen Salut als Geste der Verhöhnung, die er nicht ertragen kann, und öffnet daraufhin seinen Helm. Die Kilrathi-Führung wird im Verlauf des gesamten Krieges nie lernen, dass die Menschen ihr Leben im Kampf nie blindwütig oder aus Gründen der Ehre opfern, sondern wenn dann stets kalkuliert und aus taktischen Gründen. Die größere strategische Flexibilität der Konföderation wird die Kilrathi immer wieder teuer zu stehen kommen, ja ihnen trotz aller Überlegenheit den Sieg kosten. Am Ende des Romans bricht der Imperator aufgrund der hohen Verluste unter den Landungstruppen die ganze Operation ab, obwohl die terranische Flotte zu diesem Zeitpunkt gar nicht in der Lage ist, zeitnah einen größeren Gegenschlag durchzuführen - und der Planet quasi auf dem Silbertablett liegt. Die Befürchtung, weitere Angehörige seines Clans zu verlieren, überwiegt die strategische Vernunft, McAuliffe zu besetzen. So bleibt die Basis letztlich weiterhin in konföderierter Hand.
Der Epilog des Romans macht deutlich, welcher Hybris die Kilrathi aufgesessen sind, als sie glaubten, den Krieg mit einem Überraschungsschlag schnell entscheiden zu können. Trotz des Verlustes von 70% der Flotte sowie 150 Systeme geht die Konföderation vereinigt in den Krieg und wird von nun an 35 Jahre lang erbitterten Widerstand leisten. Die anfangs noch antimilitärisch eingestellten Politiker erweisen sich schließlich als Heuchler, allen voran Senator More, der nun zum unerbittlichen Kriegsbefürworter mutiert. Dennoch stellt der Autor die Stärke einer Demokratie in den Vordergrund, wenn er Commander Turner zum Schluss dozieren lässt, dass die guten Politiker sich letztlich doch stets durchsetzen würden. Im Falle von Wing Commander geschieht das jedoch meist erst hinterher bzw. viel zu spät! Vor der Schlacht um die Erde in „Die Geheimflotte“ war jedenfalls ein ähnliches politisches Versagen zu beobachten, und man muss ehrlicherweise auch der Menschheit attestieren, aus ihren Fehlern einfach nicht die richtigen Lehren zu ziehen. Dass die klugen Mahner oftmals überstimmt werden, hat in der Politkk zweifellos eine lange Tradition. Chapeau, Herr Autor!
Dass der aufmerksamen Leser in „Die Bedrohung“ so manches Déjà-vu erlebt, ist allerdings nicht die Ausnahme, sondern vielmehr Programm. Alle militärhistorischen Parallelen können nicht kaschieren, dass William Forstchens fünfter WC-Roman auf bewährte, wenn auch längst bekannte Zutaten setzt. In Punkto Handlung setzt der Autor auf strukturelle Versatzsstücke, Elemente und Szenarien, die uns aus den vorherigen Romanen mittlerweile vertraut sind. Da lässt sich einiges aufzählen:
Ein militärisches Kommandounternehmen, das einen bevorstehenden Großangriff der Kilrathi nachweisen soll (Die Geheimflotte), die Realitätsverweigerung einer Zivilregierung, die solch ein Unternehmen notwendig macht (ebenso), die Unterstützung des Landreichs, das die Gefahr längst gerochen hat, und seine Hilfe anbietet (ebenso), junge Offiziere, die mit einem Himmelfahrtskommando konfrontiert sind und letztlich über sich selbst hinauswachsen (Der Hinterhalt), ein Angriff auf eine Landungsoperation der Kilrathi (ebenso), die Flucht bzw. der Abwehrkampf gegen eine Übermacht Kilrathi-Verfolger (Der Hinterhalt, Die Geheimflotte), die Übertölpelung der Kilrathi durch eine verzweifelte Kriegslist (ebenso beide), der heldenhafte Freitod zum Wohle der Konföderation (beide), politischer Disput zwischen Kiranka-Clan und Ki’ra-Clan, wobei der Herrscherclan falsch entscheidet (ebenso beide), große Verluste sowie Wut auf die politische Führung, ohne dass sich etwas ändert (beide) ...
Die Liste könnte man erweitern, keine Frage. Nichts, das wir nicht in irgendeiner Form schon einmal gelesen hätten. Als nachgereichtes Prequel, welches gewissen historischen Vorgaben zu folgen hat (s. Victory Streak), kann man dies freilich akzeptieren, doch spätestens jetzt wird mehr als deutlich, dass Forstchen alten Wein in neuen Schläuchen ausschenkt. Sollte er sich irgendwann dazu entschließen, die Reihe fortzusetzen, wären dringend ein paar neue Ideen vonnöten. Andrew Keiths „False Colors“ schlug durchaus die passende Richtung ein, doch spielt dieser Roman auch nach dem Krieg und hat damit schon automatisch ein anderes Grundszenario. „Die Bedrohung“ jedoch verfrachtet vertraute Handlungsmuster mit freilich vielen Änderungen zwei (je nach Spiel und Buch auch drei) Jahrzehnte in die Vergangenheit und zeigt uns die Figuren der vorherigen Generation. Spannend und interessant, keine Frage, doch bis auf die Verlagerung der Raumkampftaktik hin zu Jägern und Bombern geschieht nichts, das mit einigen Modifikationen nicht auch in einer anderen Phase des langen Krieges zwischen Menschen und Kilrathi vorstellbar wäre.
Fazit
Der Kriegsanfang wurde nun gekonnt in Szene gesetzt, und wir haben erfahren, welche Rolle Tolwyn dabei gespielt hat. Der fiktive Autor – wir erinnern uns an die Rahmenerzählung des Militärhistorikers – hat dem jungen Geoffrey Tolwyn hiermit ein literarisches Denkmal gesetzt. Auf die Frage, wie Tolwyn Jahrzehnte später zum Kriegstreiber und Massenmörder wurde, kann „Die Bedrohung“ jedoch keine Antwort oder Erklärungshilfe liefern. Turner schärft Tolwyn am Ende ein, dass der Dienst an der Menschheit dessen höchste Pflicht sei. Lange Zeit hat Tolwyn diesem Eid alle Ehre erwiesen. Die spätere Entwicklung zum Faschisten, der grauenhafte Selektions-Biowaffen gegen Menschen einsetzt, findet in „Die Bedrohung“ nicht den geringsten Ausgangspunkt. Die Ursache dieses fatalen Gesinnungswandels ist nicht während des Kriegsanfangs zu suchen, sondern allenfalls 30 schreckliche Jahre später. Der Jahrzehnte andauernde Krieg war es, der Tolwyn so furchtbar verändert hat, nicht die früheren Erlebnisse. Keiths „False Colors“ lehrt uns mit seinen wenigen inneren Monologen weitaus mehr über die Gesinnnung Geoffrey Tolwyns als „Die Bedrohung“. Hier wird allenfalls seine Entwicklung zum Kriegshelden vorgezeichnet, mehr aber nicht.
Eine Frage muss noch beantwortet werden: Eignet sich „Actions Stations“ (Die Bedrohung) zum Einstieg in die Lektüre der Romanreihe oder gar der Spielreihe? Meines Erachtens nicht. Der Roman setzt dafür viel zu sehr auf die Leserkenntnisse von etablierten Figuren sowie dem Kriegsausgang. Die Leser sollen bekannte Figuren als junge Personen agieren sehen und deren spätere (Kriegs-)Karrieren rückwirkend im jeweiligen Anfangsstadium erleben. Der Roman möchte rückwirkend einen Kreis schließen und keineswegs einen Anfangspunkt setzen. Bereits die Konstruktion eines fiktiven Autors, der nach dem Krieg aus Gründen historischer Aufklärungsarbeit schreibt, unterstreicht den Status eines nachgereichten Prequels für uns reelle Leser sowie Kenner der Materie. Trotz der historischen Verortung am Anfang der Wing Commander-Chronologie eignet sich „Die Bedrohung“ daher eher schlecht als Einstieg in die Bücher. Mit zwanzig Jahren Zeitdifferenz zu den Ereignissen des ersten Spiels kann von einer echten Kontinuität ohnehin keine Rede sein. Hätte sich der Autor zuvor in diesem (schwarzen) Zeitrahmen betätigt, sähe die Sache etwas anders aus. So bleibt der Roman ein einmaliger Blick auf historische Ereignisse – er beginnt nichts neu, sondern wirft einen detaillierten Blick auf die Anfänge.
Empfehle ich „Die Bedrohung“ trotz seiner Schwächen? Durchaus. Es ist nicht der beste Roman und ganz sicher nicht der notwendigste, doch Kenner und Fans der anderen Bücher kommen daran nicht vorbei. Jawohl, Kenner – dieses Buch richtet sich ganz klar an eingeweihte Leser und Spieler, die einen Blick zurück auf den Beginn des Krieges werfen wollen. Muss man ihn aber unbedingt gelesen haben? Nein, denn „Der Hinterhalt“ und „Die Geheimflotte“ bleiben weiterhin Forstchens unangefochtene Kernwerke, die die Spielserie nicht nur wertvoll ergänzen, sondern in vieler Hinsicht erst glaubwürdig zusammenbinden. „Actions Stations“ steht hier klar außen vor, da es sich historisch an den Anfang setzt, ohne die Geschichte neu erzählen zu wollen. Im Filmgeschäft sind Prequels oft das Ergebnis von Ideenlosigkeit und Geldschneiderei, doch Forstchen muss man immerhin zugute halten, einen großen Bogen schlagen zu wollen. Das ist ihm größtenteils geglückt, wenn auch nicht ohne Fehler. Sollten sich die vielen kleineren und größeren Ungereimtheiten und Widersprüche zu seinen anderen Büchern nicht mit der schlechten Übersetzung ins Deutsche (und einem saumäßigen Lektorat) erklären lassen, muss man ihm ernsthafte Schlampigkeit vorwerfen. Die erste Hälfte ließ mich daher fast auf einen Ghostwriter tippen - ein Verdacht, den ich nebenbei bemerkt nie vollständig losgeworden bin. Beweisen kann ich das freilich nicht, da sei die deutsche Übersetzung vor, doch ein komischer Beigeschmack bleibt.
Wer den Roman auslässt, verpasst also relativ wenig. Neue Ideen finden sich hier jedenfalls nur wenige, doch bleibt der Roman ein fester Bestandteil der WC-Chronologie, die in WCIII festgeschrieben wurde. Dennoch gibt es einfach wichtigere Wing Commander-Bücher, und wer diese bereits im Regal stehen hat, sollte auch für „Die Bedrohung“ ein Plätzchen freimachen können. Als zuletzt erschienenes WC-Buch ist es zurzeit gebraucht besonders günstig zu erwerben und wird in der Regel für lächerliche Cent-Beträge verramscht. Wer es noch nicht hat, sollte also aus Prinzip zugreifen. Bei „False Colors“ ist das bei weitem nicht so einfach wie hier!
Meine Bewertung auf einer Skala, falls unbedingt gewünscht: Sechs von zehn Punkten.
"Ich würde immer eine Maschine bevorzugen, die um einen schweren Jäger Kreise fliegen kann, wenn es sein muss.“ Alec "Ninja" Crisologo, Wing Commander Saga
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
9 Jahre 2 Wochen her #28789
von Arrow
"Ich würde immer eine Maschine bevorzugen, die um einen schweren Jäger Kreise fliegen kann, wenn es sein muss.“ Alec "Ninja" Crisologo, Wing Commander Saga
Arrow antwortete auf Wing Commander-Romane: Von Freedom Flight bis False Colors
Ab jetzt steht erst mal eine Pause an, doch ich plane bereits eine Fortsetzung der Rezensionen. Vor allem die Titel "Der Hinterhalt" (End Run) sowie "Die Geheimflotte" (Fleet Action) möchte ich noch ausführlich besprechen. Meines Erachtens sind die beiden auch die wichtigsten und entscheidendsten Bücher der ganzen Reihe. Besonders "Fleet Action" nimmt zwischen WC2 und WC3 eine wichtige Übergangsrolle ein, wobei Übergang eigentlich pure Tiefstapelei ist. Die Schlacht um die Erde ist wesentlich mehr als nur ein Übergangsphänomen, sondern das größte und wichtigste Gefecht in Wing Commander schlechthin. Die Ereignisse von WC3 und vor allem WC Saga sind ohne dieses Buch nur unzureichend begreiflich. End Run wiederum ist deswegen bedeutsam, weil es den ersten Angriff auf Kilrah schildert und eine neue Hauptfigur einführt. Beide Romane dürfen hier nicht unerwähnt bleiben.
Zuvor jedoch hat die Übersetzung von WC Saga Vorrang.
Zuvor jedoch hat die Übersetzung von WC Saga Vorrang.
"Ich würde immer eine Maschine bevorzugen, die um einen schweren Jäger Kreise fliegen kann, wenn es sein muss.“ Alec "Ninja" Crisologo, Wing Commander Saga
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- CommCenter
- Weltraumsimulationen
- Wing Commander Serie
- Wing Commander-Romane: Von Freedom Flight bis False Colors
Ladezeit der Seite: 0.157 Sekunden